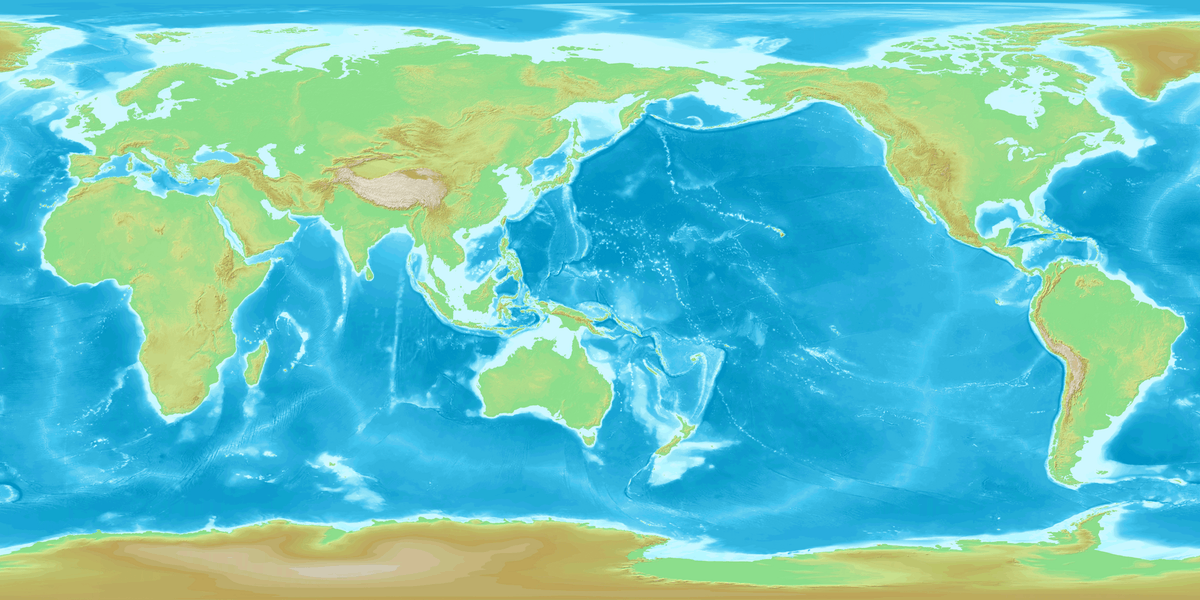
Wenn Postkolonialismus auf Postsozialismus trifft
Nach dem Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989 entstand unter Wissenschaftler:innen eine Debatte darüber, ob Postkoloniale Studien geeignete Methoden für die postsozialistischen oder postsowjetischen Situationen und Erfahrungen liefern könnten. Sie waren uneins, ob postkoloniale Theorien auf postsowjetische Gebiete anwendbar seien und ob diese nun einen postkolonialen Status hätten. Einerseits klingt es wenig wahrscheinlich, dass das postkoloniale Gedankengut, das mit Bezug auf den globalen Süden entstanden ist und (zumindest zu einem großen Teil) auch von dort kommt, eine fertigte Schablone liefern könnte, die eins zu eins auf die gelebten Erfahrungen der Bewohner:innen der ehemaligen sozialistischen Republiken Ost- und Mitteleuropas passt. Es handelt sich schließlich eindeutig um sehr unterschiedliche Kontexte und Situationen. Andererseits könnte es sehr wohl produktiv sein, diese Kontexte in Verbindung zu setzen, besonders, um über kreative Alternativen nachzudenken. Strukturelle Ungleichheiten sind in ihren vielfältigen Formen einzigartig, aber die zugrunde liegenden Logiken und Diskurse zeigen über verschiedene Kontexte hinweg Aspekte, die zueinander in Beziehung gesetzt werden können.
Innerhalb der Postkolonialen Studien sind Begrifflichkeiten und Lesarten entstanden, die helfen, sich mit den Folgen der imperialen Expansion, die von Europa ausging und den globalen Süden betraf, auseinanderzusetzen. Angesichts der Geschichte des europäischen Imperialismus, wie er vom preußischen, osmanischen, habsburgischen und russischen Reich praktiziert wurde, war den Europäer:innen aber auch die kontinentale Expansion nicht fremd. Die Diskurse, die der „internen“ und „externen“ Expansion zugrunde liegen, waren lange Zeit miteinander verwoben. Als in den 1880er Jahren die kolonialen Expansionsprojekte der westeuropäischen Mächte in Übersee an Fahrt gewannen, gab es viele Nationen in Ost- und Mitteleuropa, die keine kolonialen Herrschaftsgebiete auf anderen Kontinenten besaßen und wenig Hoffnung hatten, solche irgendwann zu erlangen. Manche von ihnen begannen Europa selbst als den Raum zu betrachten, in dem sie ihre expansionistischen Ambitionen verwirklichen mussten.
Es ist weitgehend anerkannt, dass das zaristische Russland koloniale Expansionsziele verfolgte, insbesondere in Zentralasien. Diese Bestrebungen beinhaltete sogar einen eigenen disziplinären Orientalismus. Die Sowjetunion, die als Nachfolgerin des russischen Imperiums betrachtet werden kann, führte dieses koloniale Erbe fort – eine Kontinuität, die beispielsweise durch litauische Regierungsdokumente belegt wird, in denen die „Kolonisierung“ von der zaristischen Herrschaft bis zur sowjetischen Politik nach 1945 beschrieben wird. Bezeichnenderweise haben zahlreiche Stimmen aus ehemals sozialistischen Satellitenländern erklärt, sich kolonisiert zu fühlen. In einigen dieser Kontexte war der Rückgriff auf den Postkolonialismus eine Möglichkeit, sich auf einen Diskurs zu berufen, der ihrer Erfahrungen von Marginalisierung und Unterdrückung Legitimation gibt.
Dennoch ist es wichtig, Kolonisierung nicht einfach mit jeder Art von Unterdrückung gleichzusetzen. Es ist einem tieferen Verständnis dieser konkreten Machtstrukturen nicht dienlich, die Kategorie des Postkolonialen so weit zu dehnen, dass sie keine kritische Zugkraft mehr hat. Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen eine postkoloniale Schablone nicht für postsozialistische Erfahrungen geeignet ist. Ein Beispiel ist die Situation, mit der sich ethnische Russ:innen im Baltikum nach der Auflösung der Sowjetunion konfrontiert sahen: Viele berichteten, Opfer von Marginalisierung geworden zu sein. In der Sprache des postkolonialen Diskurses bedeutet das, dass ehemalige Kolonisator:innen nun in eine Rolle schlüpft, die als „subaltern“ verstanden werden kann (die Rolle der ehemals Kolonisierten). Diese Umkehrung steht – zum Beispiel – in direktem Gegensatz zu der Situation in Südafrika nach der Apartheid. In Südafrika kontrollieren die Nachfahren der ehemaligen Kolonisator:innen immer noch einen unverhältnismäßig großen Teil der Ressourcen des Landes und führen weiterhin ein sehr privilegiertes Leben. Natürlich gibt es hier keine Eins-zu-eins-Übereinstimmung. Jede Diskussion über Vergleiche zwischen der postkolonialen und postsowjetischen Situation sollte ein Feingefühl für die existierenden Unterschiede zeigen.
Nichtsdestotrotz könnte es konstruktiver sein, „Kolonisator“ und „Kolonisierte“ nicht als feste Kategorien zu betrachten, sondern als strukturelle Positionen, die in verschiedenen Kontexten unterschiedlich besetzt werden können. Ein solches Verständnis könnte es ermöglichen, Überschneidungen und gemeinsame Logiken zu erkennen, wenn es denn welche gibt. Außerdem könnten die Methoden, die in einem bestimmten Kontext dabei helfen, die Mechanismen hinter Marginalisierung und Diskriminierung zu verstehen, als Inspiration für andere Kontexte genutzt werden.
Auch für den Postkolonialismus könnte dies eine Bereicherung sein. Menschen, die in ihrer Arbeit einen postkolonialen Fokus verfolgen, kommen womöglich an den Punkt dieses Forschungsfeld als etwas überdeterminiert zu empfinden – zumindest ging es mir manchmal so. Ich bin überzeugt davon, dass es den Postkolonialen Studien guttun würde – sie stärken würde, offen für unterschiedliche Gegenüberstellungen zu sein. Diese Offenheit kann der Suche nach Antworten auf die Fragen des Postkolonialismus einen frischen Wind geben.
