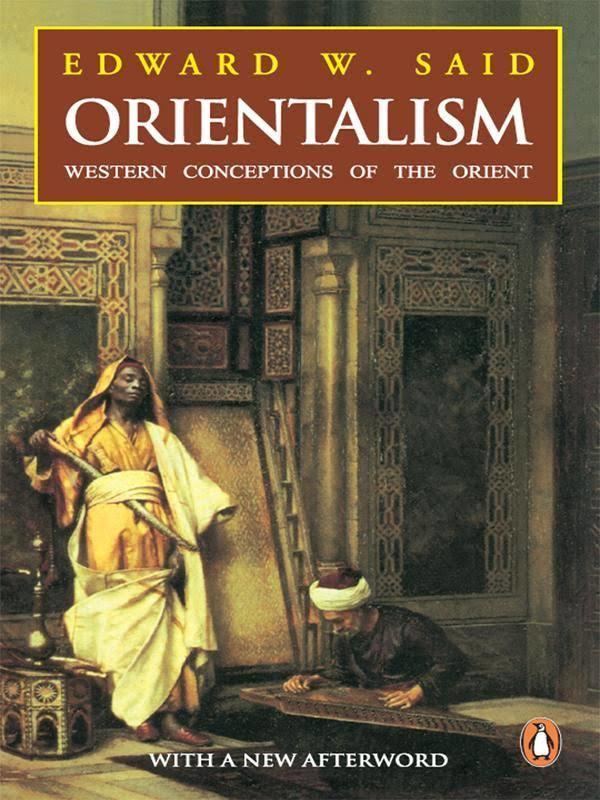
Orientalismus: eine kleine Einführung
Ein Ziel von poco.lit. ist es, zentrale Ideen des Postkolonialismus und Lesarten der dazugehörigen Literatur zu entmystifizieren, womit wir schon in diesem und diesem Beitrag begonnen haben. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf Edward Saids Orientalismus und die Aspekte, die zentral für den Postkolonialismus sind.
Edward Said, ein palästinensisch-amerikanischer Professor für Literatur, veröffentlichte 1978 eine Abhandlung über Orientalismus, die weithin als einer der einflussreichsten Texte für die Postkolonialen Studien gilt. Darin untersucht Said, wie die Kolonialmächte Frankreich und Großbritannien im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert eine Vorstellung vom „Orient“ und den dort lebenden Menschen konstruierten. Der „Orient“ sollte im Großen und Ganzen die Regionen Nordafrikas und des Nahen Ostens umfassen – doch für den Postkolonialismus haben sich viele von Saids Beobachtungen darüber, wie Repräsentation funktioniert, auch für andere geographische Regionen als nützlich erwiesen. Wahrscheinlich hängt dies mit der Tatsache zusammen, dass der Orientalismus, wie Said ihn beschreibt, ein Prozess ist, mit dem Unterschiede innerhalb enorm heterogener Räume verflacht werden. Der Orientalismus fabriziert eine Vorstellung, in der alle Menschen, die im „Orient“ leben, angeblich in gewisser Weise gleich sind.
Der Orientalismus konstruiert ein Bild durch den Diskurs – durch Repräsentationen in der Sprache, in Büchern, in Institutionen, in der Kunst und anderen kulturellen Praktiken. Es ist wichtig festzuhalten, dass dieser „Orient“ und die dort lebenden Menschen, die diskursiv zum Leben erweckt werden, laut Said keine realen Entsprechungen in der Wirklichkeit haben; sie sind eine (westliche) Fantasie. Aber die Tatsache, dass das Bild des Orients imaginär ist, ändert nichts daran, dass daraus sehr reale materielle Konsequenzen entstehen können – die Folgen haben kolonisierte Menschen und Regionen bereits erlebt. Der Orientalismus, den Said beschreibt, hat sowohl zum Kolonialismus beigetragen und ihn außerdem gerechtfertigt. Said erklärt, dass es nicht ausreicht, den Orientalismus als eine Rationalisierung der Kolonialherrschaft zu verstehen. Damit würde ignoriert werden, wie sehr der Orientalismus auch schon im Voraus die Kolonialherrschaft rechtfertigen musste.
Der Diskurs, auf dem das Konzept des Orientalismus aufbaut, befasst sich im Wesentlichen mit der Konstruktion binärer Oppositionen. Dieser Begriff wurde von Said aus der Linguistik übernommen und beschreibt die Idee, dass Menschen Dinge in Bezug auf das verstehen, was sie nicht sind. Der Orientalismus diente der Konstruktion der binären Opposition Europa/Orient. Dies ermöglichte es dem Europäer (und in diesem Fall wurde meist von einem Mann ausgegangen), sich selbst als all das zu verstehen, was ein Mensch aus dem „Orient“ nicht war: der Europäer war rational und tugendhaft usw., weil Menschen im „Orient“ es nicht waren. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um den Prozess des Otherings (um den Prozess, eine Person oder Gruppe zum Anderen zu machen). Es wird ein „Wir“ und ein „Sie“ konstruiert und es folgt eine Hierarchisierung: In der vom Orientalismus verkündeten und als universell angenommenen Weltsicht ist es besser, rational und tugendhaft zu sein – und es ist besser, europäisch zu sein. Mit der so konstruierten Überlegenheit ließ sich der eigene Auftrag erklären und rechtfertigen, dass europäische Kolonisatoren über kolonisierte Völker herrschen sollten. Letztendlich geht es also schlichtweg um Macht.
Die Beziehung zwischen Macht und Wissen spielt eine zentrale Rolle in der Funktionsweise des Orientalismus. Der Orientalismus macht den „Orient“ und die dort lebenden Menschen nämlich zum Objekt seiner Wissensproduktion. Die Europäer maßten sich also die Macht an, dieses Ding namens „Orient“ zu kennen, und produzierten das, was dann zum legitimen „Wissen“ über diesen Orient (und die Welt) wurde. Gleichzeitig nutzten sie ihre Wissensproduktion als Legitimation dafür, dass sie überhaupt die Fähigkeit hatten, Wissen zu produzieren, und damit eine „Autorität“ über den „Orient“.
Viele dieser Probleme und ihre Auswirkungen sind auch heute noch zu beobachten. Said nennt eine Reihe von Stereotypen, die noch immer in den populären Medien zu finden sind: Dazu gehören problematische Darstellungen von Nichteuropäer:innen, die Assoziationen von Gewalt, Unehrlichkeit, Faulheit usw. hervorrufen. Der Orientalismus konstruierte den „Orient“ als rückständig und primitiv (Gründe dafür, dass er die Hilfe der „fortgeschrittenen“ Europäer benötigte) – und Versionen dieses Narrativs der (mangelnden) Entwicklung sind heute noch in der Art und Weise, wie viele Menschen über den afrikanischen und asiatischen Kontinent sprechen, deutlich erkennbar. Die Frage, was als „Wissen“ gilt, ist integraler Bestandteil vieler Projekte zur Dekolonisierung von Universitäten und Lehrplänen. Und es sind die gleichen Fragen, die zeitgenössische Literatur, die koloniale Erkenntnistheorie – oder Wissensproduktion – hinterfragt, so interessant und aufregend machen – zum Beispiel Die ambivalenten Stärken von spekulativer Fiktion, Lagune, und Süsswasser.
Natürlich können einige Aspekte von Saids Orientalismus kritisiert werden, das Buch ist ja auch nicht mehr druckfrisch. Dazu gehört, dass er weder den Widerstand innerhalb des so genannten Orients noch den des Westens thematisiert. Dennoch handelt es sich um eine Theorie, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Entstehung der postkolonialen Studien hatte, und eindrücklich erklärt, wie Othering funktioniert.
